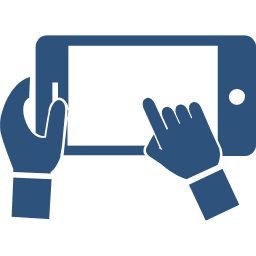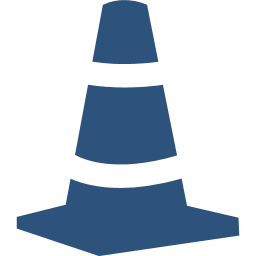Calw ist ein lebendiges und prosperierendes Zentrum, eingebettet in die ländliche Natur des Nordschwarzwaldes, mit hoher Lebensqualität.
Die familiär geprägte Gemeinde zeichnet sich durch ein herausragendes Kultur- und Bildungsangebot aus.
Dabei versteht sich Calw als Stadt engagierter, offener und selbstbewusster Bürger mit reicher Historie und starker Wirtschaft von Klein- und Mittelständischen bis hin zu Hidden Champions auf dem Weltmarkt.
- Vielfältiges Schul- & Kitaangebot sowie musikalische Breiten- & Spitzenförderung
- Starker Wirtschaftsstandort mit hochwertigen Arbeitsplätzen
- Attraktive Tourismusdestination für Gäste der Natur und Kultur
- Moderne und flexible Bürgerverwaltung für alle Lebenslagen